Sinnvollerweise müßte man die Frage auf die Entstehung und Evolution tatsächlich auf der Erde entstandener Organismen und ihrer Vorstufen beschränken; ob sich auf anderen Planeten unter anderen Voraussetzungen ebenfalls lebende Systeme entwickelt haben, müssen wir hier völlig außer Betracht lassen. Die Voraussetzungen, um ein System als lebend zu bezeichnen, sind:
Jede Eigenart für sich kann bereits der einen oder der anderen besprochenen Molekülklasse zugeschrieben werden, doch keines der Moleküle allein erfüllt alle Bedingungen gleichermaßen.
Es kann als bekannt vorausgesetzt werden, daß alle Zellen sowohl Nukleinsäuren als auch Proteine enthalten, und es ist ferner bekannt, daß zwischen Vertretern beider Klassen enge Beziehungen bestehen. Damit kommen wir unserem Problem, "Was ist Leben?", schon einen entscheidenden Schritt näher. Leben kann als eine Systemeigenschaft aufgefaßt werden, an dem Vertreter verschiedener Molekülklassen als Systemelemente beteiligt sind.
Wie weit kommt man dabei mit Proteinen und Nukleinsäuren? Die genetische Information dient zur Bildung von Polypeptidketten (Proteinen). Der Wert der in Nukleinsäuren enthaltenen Information liegt darin, die Synthese bestimmter Proteine sicherzustellen. Besonders wertvoll sind primär solche, die ihrerseits an der Replikation der Nukleinsäuren mitwirken und somit eine weitgehend fehlerfreie Weitergabe von Information bewerkstelligen. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für eine Fortentwicklung (eine Evolution) erreicht, denn eine Evolution ist nur dann vorstellbar, wenn ein einmal erreichter Informationsstand erhalten und weiter ausgebaut werden kann.
Die genannten Abhängigkeiten lassen sich in Form eines Hyperzyklus darstellen.
Hierarchie zyklischer Reaktionsnetzwerke (chemische Transformation > katalytische Aktivität). 1. Katalysatoren (Enzyme, E) katalysieren aufeinanderfolgende Reaktionen (Beispiel: Citratzyklus). 2. Autokatalyse (selbstreplizierende Einheit). Ein Enzym katalysiert die Bildung eines zweiten Enzyms, das die Bildung eines dritten usw. En schließlich katalysiert die Bildung von E1. Der Kreis ist damit geschlossen. 3. Katalytischer Hyperzyklus. Ein autokatalytischer Prozeß instruiert den Ablauf eines darauffolgenden. Der Gesamtablauf ist in sich wieder autokatalytisch (Nach M. EIGEN und P. SCHUSTER, 1977).
Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluß nicht linearer Gleichungen, oder anders gesagt, um Reaktionen zweiter Ordnung. Ein Hyperzyklus unterscheidet sich in ganz wesentlichen Merkmalen von einem Kreisprozeß. Strenggenommen beschreibt er eine Reaktionskette, die eigentlich in Form einer Schraube darzustellen wäre, denn er symbolisiert einerseits eine Wachstumsfunktion, andererseits aber auch einen Regelkreis (mit Rückkopplung). Beide Eigenschaften hängen ursächlich miteinander zusammen; eine Rückkopplung ist die wohl wichtigste Voraussetzung von Selbstverstärkereffekten. Kleine Ursachen können daher große Wirkungen auslösen, und damit sind wir einen weiteren wesentlichen Schritt auf dem Weg vom Einfachen zum Komplexen vorangekommen.
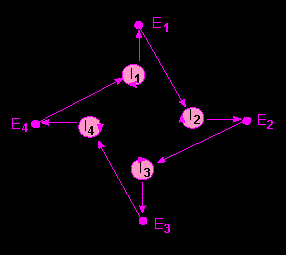
Modell eines Hyperzyklus zweiter Ordnung. Der Informationsträger I1 instruiert zweierlei. Einmal seine eigene Replikation, zum anderen die Produktion von E1....En. Damit wird die Reproduktion eines nachgeschalteten Informationsträgers (Ii+1) katalysiert. Der Ablauf der Reaktionskette ist gerichtet (Nach M. EIGEN und P. SCHUSTER, 1977).
Warum muß sich ein solches System überhaupt vermehren können? An anderer Stelle wurde schon klargestellt, daß alle lebenden Systeme als offene Systeme zu charakterisieren sind, welche nur weit von einem stabilen Gleichgewicht existieren können und daher auf ständige Energiezufuhr angewiesen sind. Denn große Moleküle und molekulare Komplexe haben die Tendenz, zu zerfallen und somit den Zustand höchster Entropie anzustreben (2. Hauptsatz der Thermodynamik) . Moleküle, und damit natürlich auch die informationstragenden Moleküle, haben demnach nur eine beschränkte Lebensdauer, und es bedarf einer ständigen Neusynthese, um eine Information zu erhalten. Aufbaurate und Zerfallsrate sind keine konstanten Größen, sie unterliegen mehr oder weniger starken Fluktuationen. Ein System hat deshalb nur dann eine Überlebenschance, wenn die Aufbau-(Synthese-)-Rate wesentlich über der (maximalen) Amplitude des Zerfalls liegt.
In einem Hyperzyklus instruiert ein Nukleinsäuremolekül die Synthese mehrerer (vieler) gleichartiger Proteinmoleküle, welche wiederum an der Synthese neuer Nukleinsäuremoleküle mitwirken. Die Menge an synthetisiertem Material steigt somit exponentiell an (Kaskadenwirkung). Rein theoretisch könnte ein Hyperzyklus beliebig oft durchlaufen werden, wenn genügend Ausgangsmaterial und ausreichend nutzbare Energie vorhanden wären, doch beides war schon immer knapp.
Da Hyperzyklen autokatalytische Prozesse beschreiben, können durch sie organisiertes Material und Information akkumuliert werden. Mangel an Ausgangsmaterial (Nukleotide, Aminosäuren u.a.) einerseits, und Energie andererseits, führt zwangsläufig zur Selektion besonders effizienter (schnell und mit der minimal erforderlichen Anzahl von Zwischenstufen arbeitender) Hyperzyklen. Entscheidend ist das, was wir unter Fitneß verstehen ; die Evolution von Eigenschaften nämlich, die den maximalen Fortpflanzungserfolg garantieren.
Es ist schwer nachzuvollziehen, wie oft sich im Verlauf der frühen Phase der Evolution von Organismen Hyperzyklen oder Ansätze von Hyperzyklen entwickelt haben; durchgesetzt hat sich letztlich nur einer, mit all den Eigenschaften, wie wir sie in allen rezenten Zellen finden, und die hier nur durch die Stichworte Replikation, Transkription und Translation (einschließlich des genetischen Codes und der Ribosomen) ins Gedächtnis zurückgerufen werden sollen.
Obwohl die Fehlerrate der Informationsweitergabe durch die Mitwirkung der Proteine ganz erheblich verringert wird, wird sie nicht vollständig unterdrückt. Als Folge davon können sich auch im Hyperzyklus Mutationen ansammeln, denn solange die Vermehrungsrate (Aufbaurate) weit höher als die Zerfallsrate ist, ist das Mitschleppen fehlerhafter Information (genetic load) ohne signifikanten Nachteil. Sie können aber unmittelbar in Vorteile umschlagen, sobald eine Information zustande kommt, die die Fitneß des Hyperzyklus erhöht und seine Überlebenschance steigert. Überlegen wäre z.B. ein Hyperzyklus, der Informationen zur Synthese von Proteinen enthalten würde, welche ihrerseits die Bildung benötigter Aminosäuren aus ihren Vorstufen katalysieren könnten. Wir wissen heute, daß Aminosäuren, Nukleotide, und andere für den Erhalt der Zellen notwendige Moleküle, im Stoffwechsel durch eine Mehrschrittsynthese
A > B > C > D > E
(E sei ganz allgemein das Endprodukt, A das Ausgangsprodukt)
entstehen. Die Zwischenprodukte dienen ausschließlich der Weiterverarbeitung. Ihr Vorhandensein ist daher nur dann von Vorteil, wenn eine Weiterverarbeitung möglich ist. Folglich müssen sich Biosynthesewege im Verlauf der Evolution "von hinten her" aufgebaut haben; die einzelnen Schritte müßten daher in folgender Reihenfolge an Wert gewonnen haben:
- D > E
- C > D > E
- B > C > D > E
- A > B > C > D > E.
Der Schritt A > B ist, für sich alleine genommen, zunächst wertlos, denn für die Funktionsfähigkeit des Hyperzyklus wird E und nicht B benötigt; B gewinnt erst durch Umwandlung in E an Bedeutung.
Nun ein weiterer, ganz entscheidender Punkt: Die Akkumulation wertvoller Information setzt die Existenz nahezu geschlossener Reaktionsräume voraus, denn in Lösung, z.B. in einem freien Gewässer, würden die Reaktionspartner durch Diffusion verlorengehen. Jede rezente Zelle ist von einer semipermeablen Membran umgeben, die zur Hauptsache aus Lipiden und Proteinen besteht. Derart komplexe Organisationseinheiten hat es sicher nicht von Anfang an gegeben. Als Prototypen für Reaktionsgefäße in einer abiotischen Umwelt kämen daher am ehesten Gesteinsspalten (z.B. an Tonoberflächen) oder Mikrosphären in Betracht. Leben ist ein Optimierungsprozeß. Der Gewinn nützlicher Information durch (Punkt)-Mutationen und Selektion innerhalb einer Evolutionseinheit, ist ein langwieriger, auf Dauer wenig erfolgversprechender Weg. Wesentlich effizienter ist der Zusammenschluß von Einheiten, von denen die eine einen Satz an Leistungen erbringen kann, die andere einen hierzu komplementären.
Die Eigenart der Mikrosphären, zu fusionieren, mag als ein Hinweis darauf zu verstehen sein, daß solche Vereinigungen in der Tat zustande kommen konnten.
Sicherlich waren die Interaktionen zwischen Reaktionseinheiten ("Protozellen"; räumlich voneinander isolierten Hyperzyklen) ebenso vielfältig wie diejenigen zwischen rezenten Zellen. Die Interaktionspotenz steigt mit der Expression und der Entwicklung von Signalen an der äußeren Oberfläche der "Protozellen". Ihr Vorhandensein bedingt Selektivität und erlaubt eine Unterscheidung von gleichartig (oder einander komplementär) und fremd.
In welcher Reihenfolge einzelne Ereignisse auftraten, ist kaum nachvollziehbar. Doch je mehr man über die Struktur von Proteinen weiß, um so plausibler erscheint die Rekonstruktion der Evolution von Stoffwechselwegen. Im einfachsten Fall ist ein Stoffwechselweg (Biosyntheseweg) eine lineare Abfolge mehrerer durch Proteine (Enzyme) katalysierter Reaktionen. Im Stoffwechsel rezenter Zellen sind Verzweigungen solcher Reaktionsketten häufig; eine Substanz X z.B. kann alternativ (nach Bedarf!) zu Y oder zu Z weiterverarbeitet werden.
Enzyme bestehen in der Regel entweder aus einer oder aus mehreren Polypeptidketten (Untereinheiten); Proteine, die aus mehreren bestehen (die eine Quartärstruktur ausbilden), sind regulierbar. Das Verhalten der Untereinheiten ist kooperativ (allosterisch). Solche Proteine sind gegenüber jenen, die aus nur einer Polypeptidkette bestehen, an Leistung überlegen. Viel spricht dafür, daß sich der Zuwachs an Leistung durch Zusammenschluß von Untereinheiten erst im Anschluß an die Perfektionierung der katalytischen Aktivität entwickelt hat. Regulierbare Enzyme stehen oft am Anfang einer Biosynthesekette oder unmittelbar hinter Verzweigungspunkten. Daraus folgt, daß es einerseits zwar vorteilhaft ist, einen bestimmten Biosyntheseweg auszubilden, daß es darüber hinaus aber besser ist, ihn nur bei Bedarf zu nutzen.
Viele Enzyme arbeiten unter Mitwirkung spezifischer Koenzyme, und es ist auffallend, daß viele von ihnen in die Klasse der Nukleotide gehören oder Nukleotide als Teile enthalten. Demnach sieht es ganz so aus, als seien Komplexe aus Protein und Koenzym Überreste oder Parallelentwicklungen einer Wechselwirkung zwischen Proteinen und Nukleinsäuren. In den letzten Jahren wurde deutlich, daß manche RNS-Moleküle allein bereits katalytische Aktivitäten ausüben können. Solche Aktivitäten wurden beim Ausschneiden von Introns festgestellt. Es gibt Fälle, in denen ein RNS-Molekül zwei andere miteinander verknüpfen kann. Basenpaarungen spielen dabei eine entscheidende Rolle in der Substraterkennung, wodurch das Evolutionspotential weitgehend eingeschränkt ist. In einer frühen Evolutionsphase mögen die katalytischen Aktivitäten der RNS eine größere Bedeutung gehabt haben als heute.
In rezenten Zellen können insgesamt mehrere Tausend verschiedene Enzymaktivitäten nachgewiesen werden. Es ist ganz unwahrscheinlich, daß sie alle unabhängig voneinander entstanden sind. Viel wahrscheinlicher ist, daß bestimmte Enzyme aus Änderungen bereits vorhandener hervorgegangen sind. Unter diesem Aspekt müßte man den Verwandtschaftsgrad der Enzyme untereinander ebenso ermitteln können wie etwa den Verwandtschaftsgrad der Organismen. Die Ergebnisse müßten sich zu einem Stammbaum zusammenstellen lassen. Die bisher vorliegenden proteinchemischen Daten sowie die Aufklärungen von Tertiärstrukturen weisen unmißverständlich darauf hin, daß das tatsächlich zutrifft und daß auch Enzyme (und andere Proteine) zu Familien zusammengefaßt werden können, deren Mitglieder sich in vielen Einzelheiten ähneln oder sogar gleichen, so daß sie als Produkte einer Diversifikation eines einst gemeinsamen Urgens anzusprechen sind.
 Position
der NAD+-bindenden Domäne innerhalb von Polypeptidketten
verschiedener Dehydrogenasen. Die unterschiedlichen substratbindenden Domänen
sind farbig gekennzeichnet. Die nukleotidbindende Domäne selbst besteht
aus zwei gleichartigen Abschnitten (hellblau, magenta), die sich
im Verlauf der Evolution aus einem gemeinsamen Vorfahr entwickelt haben.
Die einzelnen Dehydrogenasen (LDH: Lactatdehydrogenase, GAPDH: Glycerinaldehydphosphatdehydrogenase,
L-ADH: Lösliche Alkoholdehydrogenase, MDH: Malatdehydrogenase) unterscheiden
sich durch ihre Substratspezifität. Die wiederum beruht auf der Verknüpfung
der nukleotidbindenden Domänen mit zusätzlichen Abschnitten am
C- oder N-terminalen Ende (Nach W. EVENTOFF und M. G. ROSSMANN, 1976).
Position
der NAD+-bindenden Domäne innerhalb von Polypeptidketten
verschiedener Dehydrogenasen. Die unterschiedlichen substratbindenden Domänen
sind farbig gekennzeichnet. Die nukleotidbindende Domäne selbst besteht
aus zwei gleichartigen Abschnitten (hellblau, magenta), die sich
im Verlauf der Evolution aus einem gemeinsamen Vorfahr entwickelt haben.
Die einzelnen Dehydrogenasen (LDH: Lactatdehydrogenase, GAPDH: Glycerinaldehydphosphatdehydrogenase,
L-ADH: Lösliche Alkoholdehydrogenase, MDH: Malatdehydrogenase) unterscheiden
sich durch ihre Substratspezifität. Die wiederum beruht auf der Verknüpfung
der nukleotidbindenden Domänen mit zusätzlichen Abschnitten am
C- oder N-terminalen Ende (Nach W. EVENTOFF und M. G. ROSSMANN, 1976).
Ein anschauliches Beispiel bietet die Globinfamilie, zu der die tierischen Hämoglobine und Myoglobine und das in Pflanzen (Leguminosen) nachgewiesene Leghämoglobin gehören. Leghämoglobin zeichnet sich wie die Hämoglobine durch die Fähigkeit zur reversiblen Sauerstoffbindung aus. In Zellen von Leguminosenwurzeln ist es an der Schaffung sauerstofffreier oder sauerstoffarmer Kompartimente beteiligt, wodurch den dort in Symbiose lebenden Knöllchenbakterien (Rhizobien) die Möglichkeit zur Stickstoffixierung gegeben wird.
Die Tatsache, daß strukturell ähnliche und funktionell fast gleiche Globine in tierischen und in pflanzlichen Zellen vorkommen, weist darauf hin, daß die Gene für die rezenten Proteine entweder Nachfahren eines sehr alten Urgens sind oder aber daß bestimmte codierende Sequenzen (Exons) stets von neuem kombiniert werden, so daß dadurch gleichartige (analoge) Produkte entstehen, sobald ein entsprechender Selektionsdruck vorhanden ist.
Ein weiteres Beispiel hierzu (vgl. o. Abbildung): Viele Dehydrogenasen arbeiten mit NAD als Koenzym. Der NAD-bindende Abschnitt (Bereich) des Proteinmoleküls (Apoenzyms) ist bei allen diesen Dehydrogenasen gleich. Die einzelnen Vertreter der Enzymfamilie unterscheiden sich aufgrund ihrer Substratspezifität (z.B. Alkoholdehydrogenase, Lactatdehydrogenase, Malatdehydrogenase usw.). Die Spezifität erwarben sie im Verlauf der Evolution durch Kopplung des NAD-bindenden Abschnitts an solche Abschnitte, die für die Substratspezifität verantwortlich zu machen sind.
Kopplung bedeutet primär, daß Nukleotidabfolgen neu miteinander kombiniert worden sind. Als Folge davon erscheinen Proteine, die aus mehreren funktionellen Teilen (Domänen) bestehen. Anders gesagt: Die Evolution der Proteine war nicht allein auf die Akkumulation von Punktmutationen (Austausch einzelner Basen in der Nukleinsäure) beschränkt, sondern verlief nach einem Baukastenprinzip, nach dem ganze Informationseinheiten (Teile von Genen) neu kombiniert wurden.
Seit etwa 25 Jahren weiß man, daß viele, wenn nicht die meisten Gene der Eukaryoten (und der Archaebakterien) aus Stücken bestehen, die im Genom durch nicht-codierende Abschnitte voneinander getrennt sind. Dieses Organisationsschema des genetischen Materials hat sich offensichtlich unter dem Selektionsdruck gehalten, möglichst schnell und vor allem verlustarm neue Proteine entstehen zu lassen.
Molekularbiologische Untersuchungen der letzten Jahre gaben Aufschluß über Mechanismen solcher Rekombinationen. Viele der Prozesse laufen nach Prinzipien ab, wie sie seit einiger Zeit in den Laboratorien als "Gentechnik" nachvollzogen werden können.
Die hier an zwei Beispielen dargestellte Evolution der Proteine hat zu einer Diversifikation ihrer Leistungen geführt. Zugleich gewinnen wir hierdurch einen Zugang, um die Evolution der Stoffwechselwege zu verstehen. Wir werden diese Argumentation im folgenden Thema noch einmal aufgreifen, da uns damit ein Weg gezeigt wird, die Entwicklung energieumwandelnder Mechanismen (Photosynthese und Atmungskette) zu analysieren.
Unabhängig von diesen Betrachtungen lassen sich Strukturen (z.B. Aminosäuresequenzen) homologer Proteine (also solcher mit gleicher Funktion) aus verschiedenen Organismen untereinander vergleichen, um den Verwandtschaftsgrad der Organismen besser verstehen zu können. Dieser Ansatz beruht auf der Annahme, daß mit der Evolution der Organismen eine Evolution der sie aufbauenden Proteine einherging. Da Proteine primäre Genprodukte sind, nahm man ursprünglich an, sie seien weniger als andere Merkmale einer Selektion unterworfen und das Studium der Proteine würde direkte Aussagen über die Evolution der ihnen zugrunde liegenden Gene zulassen. Heute weiß man, daß auch Proteine einem Selektionsdruck unterliegen. Nur, die Evolutionsgeschwindigkeit der Proteine unterscheidet sich merklich von der Evolutionsgeschwindigkeit der Organismen, aus denen sie isoliert worden sind. Das beruht vor allem darauf, daß in der Umwelt der Organismen andere Selektionskriterien gelten als in der Umwelt der Proteine. Deren Umwelt ist der Zellinhalt, und dessen Zusammensetzung ist weitgehend konstant. Sie hängt vornehmlich von den Eigenschaften des Genoms der Zelle ab. Es können daher nur solche Zellen überleben, deren Proteine sich in das Netzwerk des Stoffwechsels einfügen. Es ist demnach auch nicht von Vorteil, wenn sich ein Enzym mit einer wesentlich höheren Aktivität entwickelt. Dadurch würde das Substratangebot in eine bestimmte Richtung kanalisiert, es würde als Ausgangsmaterial anderer Stoffwechselwege fehlen; die Zelle als Ganzes würde in Mitleidenschaft gezogen werden und der Selektion zum Opfer fallen. Die Selektion wirkt folglich nicht auf einzelne Genprodukte, sondern auf die Gesamtheit des Genoms der Zelle.
Die Evolutionsgeschwindigkeit besonders "wichtiger" Proteine ist extrem niedrig. Das klassische Beispiel hierfür ist das Histon IV, dessen Aminosäuresequenz beim Rind und bei der Erbse nahezu gleich sind. Andere, weniger "wichtige" Proteine, wie Speicherproteine, unterliegen einem geringeren Selektionsdruck in Richtung Strukturerhaltung, so daß Unterschiede in ihren Aminosäurezusammensetzungen bereits beim Vergleich nahverwandter Arten nachweisbar sind. Von Art zu Art verschiedene Aminosäurezusammensetzungen findet man auch bei der Ribulose-1,5-Bisphosphat-carboxylase, dem Enzym, das den ersten Schritt der Kohlendioxyd-Fixierung bei der Photosynthese katalysiert.
Zusammenfassend können wir sagen, daß durch das Studium der Struktur und der Eigenschaften von Proteinen die zunehmende Komplexität zellulärer Funktionen verständlich wird.
|
|